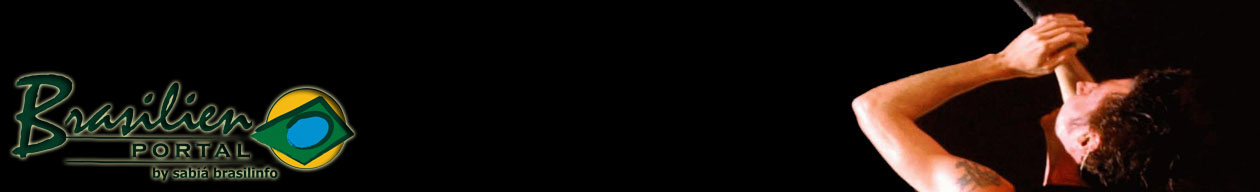Abseits der bekannten Navigationsrouten des mittleren Rio Purus hat das Volk der Zuruahã seine vorsichtige Isolation bis zum Ende der 1970er Jahre aufrecht erhalten können. Schliesslich wurden sie von Missionaren des Munizips Lábrea kontaktiert, nachdem diese von ihrer Existenz durch einen Konflikt mit Waldarbeitern erfahren hatten, die in das indigene Territorium eingedrungen waren.
Eine ganz ungewöhnliche Charakteristik dieser indigenen Gruppe ist ihre hohe Suizid-Rate, welche in engem Zusammenhang mit ihrem kosmologischen System und der erlittenen territorialen Einengung der vergangenen Jahrzehnte steht. (Details behandeln wir im Kapitel “Kosmologie und Suizid“.)
Zuruahã
|
Andere Namen: Suruwahá, Índios do Coxodoá Sprachfamilie: Arawá Population: 142 Personen (2010) Region: Bundesstaat Amazonas |
INHALTSVERZEICHNIS Sprache und Identifikation Lebensraum und Bevölkerung Aus der Geschichte Offizieller Erstkontakt Gesellschaftliche Organisation Gesellschaftliche Einheiten Verwandtschaft Führung und Geschlecht Lebenszyklus Kosmologie und Suizid Der angekündigte Tod Der Tod im kosmologischen Aspekt Schamanistisches Modell – Suizid-Modell Produktive Aktivitäten |
 Sprache und Identifikation
Sprache und Identifikation
Die Zuruahã sprechen einen Dialekt aus der linguistischen Familie Arawá, zu der auch die “Jamamadi, die Kanamanti, die Jarawara, Banawa, Deni, Paumari und die Kulina“ gehören. Alle Repräsentanten dieser Sprachfamilie bewohnen sie Region zwischen dem Becken des Rio Purus und dem Becken des Rio Juruá, in ihrem mittleren Verlauf – beide sind grosse Nebenflüsse des Rio Solimões, der mit dem Rio Negro den Amazonas-Strom bildet.
Nach einem ersten Kontakt mit Mitgliedern des CIMI (Indigener Missionsrat) wurde das Volk der Zuruahã bekannt als die “Índios do Coxodoá“ (Indianer vom Coxodoá) einem kleinen Flüsschen, an dem man sie erstmals angetroffen hatte. Was den Namen betrifft, unter dem man sie heute identifiziert, so haben sie den eigentlich von einer bereits ausgestorbenen Gruppe übernommen – nämlich von den “Sorowaha“ am Ufer des Rio Cuniuá, deren berühmte Schamanen bis heute unvergessen sind. Anfänglich war die Bezeichnung “Zuruahã“ eher eine Art Provisorium, mit dem man die Neugier der Wissenschaftler zu befriedigen gedachte, wurde aber bald anerkannt als ein Name von Prestige und Respekt – auch von den Indios selbst. Trotzdem gibt es immer noch ein paar Unzufriedene, die diesen Namen mit dem Argument ablehnen, dass sie alle als “Jokihidawa“ zu bezeichnen seien, weil sie inzwischen im Gebiet des Igarapé (Flüsschens) Jokihi leben.
 Lebensraum und Bevölkerung
Lebensraum und Bevölkerung
Die Zuruahã bewohnen die Hochebenen zwischen den Flüsschen Riozinho und Coxodoá, rechtsseitige Nebenflüsse des Rio Cuniuá – mit seinem Verlauf in östlicher Richtung, ist letzterer einer der Quellflüsse des Rio Tapauá, einem bedeutenden linken Nebenfluss des Purus-Beckens, im Bundesstaat Amazonas.
Das Indigene Territorium Zuruahã (IT) befindet sich in einer typischen Zone der “Terra Firme“ (Festlandswald), bewässert von kleineren Wasserläufen, die einmal im Jahr, während der Regenperiode (November bis April), an Volumen zunehmen, überlaufen und Seen und Lagunen füllen, die sich in einer nur durch wenige Hügel unterbrochenen Ebene ausbreiten. Im Januar 1996 bestand das Volk der Zuruahã aus 144 Personen. Trotz vieler Verluste in bestimmten Jahren, wuchs die Bevölkerung seit 1980 langsam an – damals waren sie gerade mal etwas mehr als 100.
 Aus der Geschichte
Aus der Geschichte
Die Zuruahã selbst berichten – es gibt dafür auch weitere historische Indizien (Barros 1930) – dass sie Überlebende verschiedener territorialer Untergruppen sind, deren Mitglieder durch Infektionskrankheiten und die skrupellose Latex-Ausbeutung, während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, drastisch dezimiert worden sind – in einer Periode der grössten Ausbeutung natürlicher Ressourcen in ganz Amazonien. Die in den historischen Berichten (Sorowaha) am meisten genannten Untergruppen sind: die “Jokihidawa“ am Igarapé (Bach) Pretão, die “Tabosorodawa“ am Igarapé Watanaha (einem Nebenfluss des Pretão), die “Adamidawa“ am Igarapé Pretinho, die “Nakydanidawa“ am Igarapé do Índio, die “Sarakoadawa“ am Igarapé Coxodoá, die “Yjanamymady an den Quellen des Igarapé São Luiz, die “Zuruahã am Rio Cuniuá, die “Korobidawa“ am rechten Zufluss des Rio Cuniuá, die “Masanidawa“ an der Mündung des Riozinho, die “Ydahidawa am Igarapé Arigó (Zufluss des Riozinho) und die “Zamadawa“ am Oberen Riozinho.
Einigen Untergruppen, darunter auch die Masanidawa und die Zuruahã, gelang eine freundschaftliche Verbindung zu den Latex-Sammlern (den “Jara“, so nennen sie die “Zivilisierten“), und so erhielten sie von ihnen Kleidung und Werkzeuge – Beile, Haumesser und Angelhaken – Dinge, die sie alsbald auch zum Tauschen mit den anderen Gruppen benutzten. Doch sie zahlten einen hohen Preis für die Geschenke der Gummisammler: Grippe-Epidemien wüteten unter ihnen (der Assistent des SPI (Indianerschutz), José Sant’Anna de Barros, registrierte im Becken des Rio Tapauá 1922 und 1924 solche Vorfälle, mit einer hohen Zahl an Opfern) – ausserdem wurden sie von ihren Todfeinden, den “Paumari“ des Unteren Tapauá, mit Feuerwaffen angegriffen, die diese von den Gummibaronen erhalten hatten. Die wenigen Überlebenden unterschiedlicher Untergruppen flüchteten in die Umgebung des Igarapé Jokihi (den die Regionalen “Pretão“ nennen), so weit wie möglich weg von den befahrbaren grossen Flüssen und den dort eingedrungenen weissen Siedlern. Sie schlossen sich den “Jokihidawa“ an (wörtlich: “den Leuten des Jokihi“), einer Untergruppe, die seit eh und je dort ansässig war.
 Offizieller Erstkontakt
Offizieller Erstkontakt
Der FUNAI war die Existenz dieser Gruppe schon seit Mitte der 1970er Jahre bekannt. Aber erst im Dezember 1983 unternahm eine Expedition des Indianer-Schutzdienstes, genannt “Operation Coxodoá“, einen offiziellen Kontaktversuch – bestehend aus zwölf Personen, inklusive Indios Waiwai und Waimiri-Atroari als Fährtensucher und Interpreten. Die Expedition fand insgesamt acht indigene Dörfer vor – an den Wasserläufen Igarapé do Índio und dem Igarapé Preto – beide sind Nebenflüsse des Rio Cuniuá.
Noch vorher, im Jahr 1978, hatten diese Indios bereits mit Mitgliedern des CIMI (Indigener Missionsrat) Kontakt aufgenommen, und die Missionare pflegten sie seither mit gewisser Regelmässigkeit zu besuchen.
1984 wurde die Arbeitsgruppe zur Identifizierung des indigenen Territoriums geschaffen, in der sowohl Mitglieder der FUNAI als auch der Missionsstation von Lábrea tätig wurden. 1985 wurde dann eine Fläche von 233.900 Hektar, innerhalb des neu geschaffenen Munizips Camaruã, vorgeschlagen. Der Situationsbericht deutete an, dass sich die Dörfer der Indios zwischen den Igarapés Pretão und Riozinho befänden, und dass man das Territorium so weit wie möglich vom Rio Cuniá entfernt verlegen solle, wo die Anwesenheit von Weissen bereits recht häufig konstatiert worden war. Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass das demarkierte Territorium bereits von einer Front Latex-Sammler invadiert worden war.
Mit der Entwicklung des “Projekts Zuruahã“, es ist bis heute noch in Arbeit, begann man 1984 genau aus diesem Grund: um die perversen Folgen jener nicht-indigenen Besetzer-Fronten zu bekämpfen. Dabei handelt es sich um ein Programm von Hilfsaktionen zur Verteidigung des Indio-Territoriums, sowie der Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten, unter der Verantwortung einer Equipe, die sich aus Mitgliedern der OPAN (Operação Amazônia Nativa), des CIMI und der Labrea-Mission, zusammensetzt. Die Zuruahã stehen ausserdem noch unter der besonderen Aufmerksamkeit des Psychologen Mário Lúcio da Silva, der viele Jahre unter ihnen gelebt hat.
 Gesellschaftliche Organisation
Gesellschaftliche Organisation
Den grössten Teil des Jahres bleiben die Zuruahã vereint in einer ihrer weiträumigen konischen Behausungen, die im Zentrum ihres Territoriums stehen. Im Innern dieses gemeinsamen Heims findet das gesellschaftliche Leben statt, bestehend aus einem komplexen Netz an verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Verbindungen, sowie multipler Formen des Zusammenlebens.
Innerhalb der Behausung – ohne laterale Wände oder interne Abteilungen – besetzt jede Familie, mehr oder weniger zufällig, (wenn möglich, in der Nähe von Blutsverwandten eines Ehepartners), eine der “Haushaltsnischen“ (kaho) die im architektonischen Plan vorgesehen sind. Das Haus gehört dem Mann, der es gebaut hat – er ist sein Besitzer (anidawa), und er sorgt auch für die anfallenden Reparaturen, wenn die Gruppe darin wohnt, innerhalb einer Periode, die zwischen einigen Monaten und etwas mehr als einem Jahr dauern kann.
Der Hausbau gehört zu den Aufgaben der erwachsenen Männer. Im Lauf seines Lebens errichtet ein Mann vier bis fünf solcher Häuser. Die Konstruktion verlangt etwa ein bis zwei Jahre anstrengender Hingabe – alle Männer helfen bei der strukturellen Montage aus Holz, die zum Abschluss eine dicke, dichte Decke aus Palmstroh bekommt.
Der Titel “Anidawa“ wird, ausser für einen Hausbesitzer, auch für andere Besitztümer vergeben, wie zum Beispiel für den Besitz eines Feldes, den Besitz von Wertobjekten (zum Beispiel ein Boot) und für die Führung bei kollektiven Jagden oder Fischzügen. Und in jedem dieser Fälle hängen damit bestimmte Rechte und Pflichten für den “Anidawa“ zusammen, welche bei gemeinsamen Aktionen die Richtung angeben.
 Gesellschaftliche Einheiten
Gesellschaftliche Einheiten
Obwohl es noch einige Zweifel hinsichtlich des Besitzrechts und anderer Aspekte gibt, erwähnen alle ethnologischen Beschreibungen die Existenz unterschiedlicher lokaler Einheiten, unter denen Trennungen und Abwanderungen wegen interner Konflikte üblich sind. In diesem Zusammenhang kommt es auch zur Anwendung von Gewalt und vor allem auch zur Beschuldigung von Hexerei – das gegenseitige Vertrauen ist gestört, die Kooperation funktioniert nicht mehr – die Aufrührer müssen gehen.
Alles deutet darauf hin, dass unter den Zuruahã geografische Besonderheiten oder andere lokale Charakteristika eine namensgebende Bedeutung haben, um eine Untergruppe zu identifizieren, die in einem bestimmten Territorium ansässig war oder noch ist. Referenzen der von den Untergruppen oder ihren Mitgliedern bewohnten Lokalitäten tauchen in Berichten von Kriegen, Verzauberungen und antiken Wanderungen auf. Der gegenwärtige Gebrauch solcher Apelativa (Beinamen), obgleich sie etwas ungenau sind, scheint einer gewissen heimatlichen Zuneigung zu entspringen, welche meistens auf der direkteren Verbindung zu den Verwandten väterlicherseits beruht – wobei zu bemerken wäre, dass den “Bastarden“ (Söhne, die ausserehelich oder von Witwen geboren wurden), eine Mitgliedschaft innerhalb einer Untergruppe nicht zugestanden wird.
 Verwandtschaft
Verwandtschaft
Der Gegensatz zwischen Blutsverwandten und Verschwägerten, der sich rituell im Moment der maskulinen Initiation (sokoady) offenbart, entspringt einer klaren begrifflichen Unterscheidung der Verwandtschaftsgrade, in der sich eine charakteristische, dravidianische Terminologie offenbart, welche auf der positiven Regel einer Eheschliessung zwischen “gekreuzten Cousins“ beruht. Jedoch pflegen die Zuruahã im Alltag jene verwandtschaftliche Nomenklatur zu umgehen und den Gebrauch von Eigennamen oder eventuellen Spitznamen, die in der Regel auf besonderen Eigenschaften der jeweiligen Person beruhen, vorzuziehen. Ausserdem ist ihre genealogische Erinnerung selten so ausgeprägt, dass sie die Nomenklatur von fünf oder mehr Generationen zurückzuverfolgen imstande sind, und das spricht deutlich für eine Bevorzugung von Eigennamen und Spitznamen, die sich übrigens selten wiederholen. Alles spricht dafür, dass wir es mit einem System zutun haben, das sich vor allem auf die Individualität einer Person konzentriert und sie partikularisiert, aufgrund einiger persönlicher Details in einem vorgegebenen Eigenschafts- und Verhaltenskodex (Name, physische Attribute, Temperament, Fähigkeiten, etc.).
 Führung und Geschlecht
Führung und Geschlecht
Weder bei den üblichen Aktivitäten, noch in Krisensituationen, hat man bei den Zuruahã bis heute eine Führungs-Institution oder irgend ein anderes Modell politischer Zentralisierung beobachten können. In diesem Punkt scheint ihre gesellschaftliche Organisation sich von denen anderer Arawá-Stämme zu unterscheiden, bei denen ein Häuptling sich in einer bedeutenden Funktion befindet (zum Beispiel der “Tamine“ beim Volk der “Kulina“). Anstelle eines führenden Oberhauptes gibt es bei den Zuruahã eine Art “Rangordnung der Jäger“, mit hierarchischer Prägung, durch welche die Männer anhand der Anzahl ihrer erlegten Tapire eingestuft werden.
Eine starke Opposition besteht zwischen Männern und Frauen, welche die beiden Geschlechter in zahlreichen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens ungleich bewertet. Aus der Sicht beider Geschlechter sind die maskulin Geborenen ein Grund zu unbändigem Stolz, dergestalt, dass der Anspruch Söhne zu zeugen und zu gebären, fast wie eine moralische Verpflichtung angesehen wird. Tatsächlich fürchten die Frauen nichts mehr als eine “Hexerei“, welche die Empfängnis von Söhnen verhindert. Und die gesellschaftliche Anerkennung der biologischen Reife eines Individuums, das heisst, seine Entwicklung im Verlauf der verschiedenen Alterskategorien (dogoawy), wird an dem Lebenszyklus seiner maskulinen Nachkommen bemessen.
 Lebenszyklus
Lebenszyklus
Die einzelnen Phasen (sorowaha) der biologischen Entwicklung unterteilen die Zuruahã in sechs unterschiedliche Stufen:
| Entwicklungsstufen | Alter in etwa | Männer | Frauen |
| 2 bis 7 Jahre | 2 bis 7 | hawini | hazamoni |
| 8 bis zu Beginn der Teen-Phase | 8 bis 13 | kahamy | zamosini |
| Bis zur männlichen Reife | 14 bis 28 | wasi | atona |
| Bis zur Geburt eines Enkels | 29 bis 38 | dogoawy | wasi dogoawy |
| Bis zum Mannesalter des Enkels | 39 bis 52 | dogoawy | dogoawy |
| Bis zu den weissen Haaren | 53 und mehr | hosa | hosa |
Zeremonielles Leben
Innerhalb der rituellen Sphäre wird die maskuline Reife (zwischen 12 und 14 Jahren) durch die Verleihung eines “Penis-Gürtels“ (sokoady) akzentuiert – ein öffentlicher Event, bei dem es vor allem um das Thema “verwandtschaftliche Beziehungen“ geht (mit wem man sich verheiraten darf). Nach einer ausgiebigen Jagd, oder einem entsprechenden Fischzug, finden zu diesem Anlass kollektive Tänze und Verköstigungen statt – die infrage kommenden Jünglinge erhalten ihren “Penis-Gürtel“ aus Baumwollfäden und werden im Anschluss von den erwachsenen Männern geschlagen (Blutsverwandte ausgenommen). Danach erholen sie sich in Hängematten, die hoch, im Zentrum der Behausung, aufgespannt sind, während nunmehr ihre Blutsverwandten sich an einer Rauferei gegen den Rest der Männer beteiligen, die sich bemalt wie Affen aufführen und auch entsprechend gestikulieren – deshalb wird dieses Ritual “Gaha“ (Affentanz) genannt. In der letzten Etappe werden die Jünglinge dann von den Frauen zu einem Bad im nahen Bach geleitet, wo sie ihnen die Haare schneiden und sie mit der roten Farbe Urucum bemalen – in diesem Moment scherzen die Anwesenden über die eventuellen sexuellen Abenteuer der initiierten jungen Männer.
Mit der ersten Menstruation beginnt für das weibliche Geschlecht der Eintritt in das jugendliche Stadium, verbunden mit Rückzug und Isolierung im Innern des haushaltlichen Lebensraumes (mit verbundenen Augen liegen die Mädchen in ihren Hängematten, essen kaum etwas und begeben sich nur während der Nacht zur Durchführung ihrer physiologischen Notwendigkeiten nach aussen). In der effektiven Kontrolle der femininen Sexualität zeigt sich der Unterschied im Status der Geschlechter besonders deutlich, und die forcierte Unterordnung der Frauen wird offensichtlich: Ihr sexuelles Verhalten steht unter konstanter Kontrolle – die Mädchen werden häufig von ihren Eltern, Brüdern und anderen nahen Verwandten entsprechend ermahnt, und es ist ihnen verboten, ohne Begleitung das Haus zu verlassen, wegen der Bedrohung eventuellen “sexuellen Missbrauchs“ durch nicht Blutsverwandte.
In verschiedenen Momenten, und auf unterschiedliche Art und Weise, werden die persönlichen Tugenden und das individuelle Verhalten geprüft, kritisiert oder gepriesen und von der Gesellschaft entsprechend bewertet. Die Kraft der Jugend wird konstant und ostentativ zur Schau gestellt, und Demonstrationen physischer Kraftakte kann man zum Beispiel beim Bau eines neuen Hauses beobachten – an dem sich übrigens nicht nur junge, sondern auch ältere Männer in fortgeschrittenem Alter, beteiligen.
Bei den “Ritualen zur Prüfung der Kraft“ müssen erwachsene und heranwachsende Männer, einer nach dem andern, einen grossen Haufen Zuckerrohr von einer Stelle zur andern transportieren – oder einen mit geraspelter Maniokmasse gefüllten, riesigen Korb. Und was die moralischen und ästhetischen Beurteilungen der Zuschauer betrifft, kann man vielleicht den einen oder anderen anerkennenden oder vernichtenden Kommentar vernehmen: Erwägungen der physischen Ähnlichkeiten zwischen den Individuen, anerkennende Bemerkungen der verschiedensten Genres und sogar gewisser bizarrer Details der menschlichen Anatomie (wie zum Beispiel der Waden).
 Kosmologie und Suizid
Kosmologie und Suizid
Einer der einschneidensten Aspekte der Zuruahã-Gesellschaft ist die Regelmässigkeit der Selbsttötung mittels der Einnahme von Lianengift (“konaha“ – eine Pflanzenart, deren Verwendung zum Betäuben von Fischen unter den südamerikanischen Indios weit verbreitet und allgemein als “timbó“ bekannt ist). In einer genealogischen Aufstellung, die auf fünf bis sechs vergangene Generationen vor 1980 zurückreicht, wurden 122 Fälle (75 Männer und 47 Frauen) registriert. Egal welche dieser Perioden man betrachtet, stellt man fest, dass die Mehrheit jener Selbstmörder junge Leute beider Geschlechter waren (das heisst, aus den Alterskategorien “wasi“ und “atona“ stammten, also Männer und Frauen zwischen 14 und 28 Jahren (siehe die Aufstellung unter “Lebenszyklus“).
Zwischen 1980 und 1995 gab es unter den Zuruahã zirka 38 Todesfälle durch Suizid – 18 Männer und 20 Frauen – inmitten einer Bevölkerung von 125 Personen. In der gleichen Periode wurden 101 Kinder geboren und starben 66 Personen insgesamt. Auf der einen Seite also eine hohe Geburtenrate (zirka 6,3 Geburten jährlich) – auf der andern ein nur geringes demografisches Wachstum – etwa 1,9% pro Jahr. Was die Umstände der Sterblichkeit betrifft, überwiegt die intensive Praxis des Suizids mittels Vergiftung (38 Fälle innerhalb eines Gesamts von 45). Diese akzentuierte Selbstmordtendenz, zu der besonders junge Leute neigen, stellt aus der Sicht der Eingeborenen keinerlei Überraschung dar. Denn die Zuruahã sind allgemein der festen Überzeugung, dass “wasi“ und “atona“ gerne “konaha“ einnehmen – die “dogoawy“ (reife Männer und Frauen) dagegen nicht – so erklärt der Zuruahã Ohozy, ohne zu zögern.
Eine solche Neigung bestätigt allerdings gewisse, in ihrer indigenen Philosophie verwurzelte Forderungen, die dieser Etappe des biologischen Zyklusses grossen Wert beimessen – als Folge einer entscheidenden Ablehnung (und einer Verachtung) des Alterns und der physischen Dekadenz. Wie die Zuruahã erklären, ist es deshalb “nicht gut, alt zu sterben, sondern es ist gut, jung und stark dem Tod zu begegnen”! Und diese ungewöhnlichen Werte, an denen sich diese indigene Jugend orientiert, und für die sie sich in ihrem radikalen Verhalten engagiert, werden von der Suizid-Statistik zweifelsfrei bestätigt.
Die jungen Zuruahã-Mitglieder beider Geschlechter müssen hinsichtlich ihrer familiären Verhältnisse und ihrer Verbindung zum gesellschaftlichen Kollektiv, eine äusserst schwierige Phase durchmachen, eine Periode, die gleich nach jenen Zeremonien beginnt, die ihren Eintritt in das Erwachsenenleben markieren, das heisst: die Verleihung des “sokoady“ für die Burschen, und die erste Menstruation bei den Mädchen – was während der ersten Jahre ihrer Ehe weitergeht: Die Ehestreitigkeiten und das Zusammenleben mit den Verwandten steigern die beiderseitigen Gefühle zu einer explosiven Mischung.
Man darf jedoch den ausserordentlichen Nachdruck nicht vergessen, mit dem die Zuruahã-Gesellschaft die physischen und moralischen Tugenden fördert und anerkennt, vor allem jene, die der Jugend zu eigen sind. Und jedermann kennt jene verwirrenden Spannungen, von denen Burschen und Mädchen befallen werden, und die ihre individuellen Eigenschaften (physische Kraft, Talent, Disposition, Schönheit, Sexualität, etc.) hemmen. Aber genau deshalb ist die Jugend so empfänglich für eventuelle Zwistigkeiten und Ablehnungen. Diese Reibereien nehmen ab mit der Geburt des ersten Kindes – vor allem wenn es ein Junge ist – und nach und nach gelingt den Ehepaaren eine gewisse emotionale Stabilität.
 Der angekündigte Tod
Der angekündigte Tod
Die Selbstmordversuche laufen in den meisten Fällen stets nach dem gleichen Muster ab. Die Intoxikation mit dem Gift der Liane, die bei den Zuruahã mit “konaha bahi“ bezeichnet wird, ist die in diesem Fall einzig bekannte Form der Selbsttötung. Die im Fall eines Selbstmordversuchs unternommenen Aktionen – sowohl seitens des Selbstmord-Kandidaten, als auch seitens seiner Angehörigen – können in der folgenden szenischen Kurzfassung beschrieben werden:
Ein bestimmtes Ereignis provoziert eine Irritation oder einen Widerstand der betreffenden Person (nehmen wir mal einen Mann).
Ausser sich, zerstört dieser seine gesamte Habe (zerschneidet und verbrennt seine Hängematte, zerbricht seine Waffen und Werkzeuge, sowie seine Keramikutensilien.
Die Umstehenden, verwandt oder nicht, lassen ihn gewähren, damit er seine Aggressivität los wird – sie versuchen, ihre Bedrückung zu verstecken, und betont natürlich gehen sie ihren normalen Aktivitäten nach. Sie vermeiden es, den Wütenden direkt anzuschauen, verfolgen jedoch heimlich alle seine Bewegungen.
Falls er sich nach seinem cholerischen Anfall immer noch nicht beruhigt hat, stösst er plötzlich einen erschütternden Schrei aus, oder er rennt ohne Ankündigung aus dem Haus in Richtung eines Feldes, um dort eine frische Timbó-Wurzel auszureissen.
Jene, die seinen Wutausbruch bisher diskret verfolgt haben, benachrichtigen andere Personen (seine Verwandten, zum Beispiel) und einige andere Personen (in der Regel desselben Geschlechts) und verfolgen den Selbstmordkandidaten – oder, falls dieser schon ausser Sichtweite ist, suchen sie ihn auf den Pfaden, die zu einem oder anderen Feld führen.
Wenn die Verfolger ihn finden, versuchen sie, ihm die Wurzeln zu entreissen – gelingt ihnen das nicht, rennt der Selbstmörder zum nächsten Wasserlauf, um dort die Timbó-Wurzel auf einem Stein zu zerkleinern, die Bröckchen zu kauen, und den Saft zu schlucken – dann trinkt er ein paar Schluck Wasser hinterher, um damit den toxischen Effekt zu aktivieren.
Anschliessend rennt er zurück zum Haus (einige schaffen diesen Rückweg nicht und sterben schon unterwegs).
Kommt er zuhause an, wird er von seinen Verwandten behandelt – deren Rettungsoperation besteht aus dem Versuch, ihn zum Erbrechen seines Mageninhalts zu bringen, indem sie seine Speiseröhre mit Stielen von Ananasblättern kitzeln, seinen Körper mit erhitzten Fächern wärmen (einer Aufgabe der Frauen), die einschlafenden Arme und Beine beklopfen und in seine Ohren schreien, um ihn wachzuhalten – dabei halten sie ihn in einer sitzenden Position.
Im Verlauf dieser Behandlung geben sich die Helfer erzürnt mit dem Selbstmörder, reden aggressiv auf ihn ein und beschimpfen ihn.
Sein eventueller Tod jedoch, verursacht eine starke Gefühlsreaktion unter allen Mitbewohnern, die sich in einem Ritual weinerlicher Trauerintonationen manifestiert. Ein so dramatisches Ende motiviert eventuell verschiedene andere Personen (Blutsverwandte oder enge Freunde) sofort, oder nach einigen Stunden oder Tagen, ihrerseits den Suizid zu versuchen – wodurch der Beginn erneuter Verfolgungen und Rettungsversuche eingeleitet wird.
Die Symptome und physiologischen Reaktionen aufgrund der Vergiftung – wie abfallender Blutdruck, Kälteschock, Krämpfe und Schwellungen – entstehen langsam und verlangen nach mehr oder weniger Umsorgung des Patienten. Sein Überleben hängt von verschiedenen Umständen ab, darunter u.a. von der verschluckten Giftmenge, der Resistenz des Körpers in der Behandlung, der Disponibilität der Personen zu seiner Versorgung, und nicht zuletzt vom eigenen Interesse weiterzuleben.
Die Motive, wodurch ein Mitglied der Gesellschaft mit einem anderen oder mit einer Gruppe in Konflikte gerät – oder wodurch er vielleicht mit sich selbst nicht mehr zufrieden ist – diese Motive werden als Gründe für die Suizidversuche angeführt. Sie sind eingebettet in ein Netz unterschiedlicher Gefühle, die in jenen besonderen Situationen offen diskutiert werden: unter anderem die Zuneigung (kahy), die Wut (zawari), die Sehnsucht (kamonini) – vor allem in Form von Trauer um verstorbene Angehörige – und die Scham (kahkomy). Im Fall einer Trauerzeremonie werden Verwandte und Freunde gleichermassen von Zorn und Sehnsucht geplagt, und die prägen den Ausdruck ihrer Trauer in diesem kulturellen Universum.
Der Tod eines Selbstmörders provoziert nach wie vor unzählige weitere Suizidversuche, in einer Kettenreaktion, die direkte und entferntere Verwandte, Verschwägerte und selbst Freunde des Verstorbenen mit sich reisst. Dasselbe geschieht aber auch bei jedem anderen Todesfall, sei er durch einen Schlangenbiss, eine Krankheit oder einen Unfall passiert. Die letzten Ehren zur Bestattung einer Person wachsen sich dann zu einem unvergleichlichen Drama aus, das man kaum treffend beschreiben kann, denn es gipfelt in Zusammenstössen zwischen potenziellen Suizidkandidaten und jenen, die sie retten wollen, in gegenseitigen Beschuldigungen, in Drohungen und sogar in physischen Aggressionen. Auf diese Weise löst der Tod einer Person fast immer eine Reihe anderer Todesfälle aus.
1985, nach dem Selbstmord einer jungen Frau, die von ihrer Schwiegermutter verjagt worden war, starben ihre Schwester und die Schwägerin. 1986 provozierte der Suizid eines Mannes, der gegen das Verhalten seiner Ehefrau protestierte, die kein Essen für ihn kochen wollte, den Tod seines Freundes und dessen Vaters. 1987 starben die Mutter und der Freund eines Jungen, der sich getötet hatte, weil andere Personen sich über Exkremente seines Hundes beschwert hatten. Im selben Jahr schluckten zwei junge Mädchen “konaha“, weil der Grossvater der einen ihre sexuellen Eskapaden kritisiert hatte – was zum Tod ihres Bruders führte. 1989, als ein Mädchen an einem Schlangenbiss verstarb, begingen der verwitwete Vater und zwei Neffen desselben – ein junger Bursche von 14 Jahren und ein verheirateter Mann – ebenfalls Selbstmord.
Drei Monate später starben die Witwe des Letzteren, deren Schwester und der Vater des Jungen. Zwei Wochen später hatte die Schwester einer der verstorbenen Männer einen Streit mit ihrem Ehemann und brachte sich um, begleitet von einem jungen Mädchen. 1992 tötete sich ein “Hausbesitzer“, weil er sich über die Arbeit zur Instandhaltung des Hauses ärgerte, mit seiner Frau zerstritten war, und sich wegen dem Verschwinden eines Messers grämte – mit ihm töteten sich zwei seiner Brüder, sein Vater und ein Freund. Schliesslich gab es gegen Ende 1996 eine Reihe von Selbstmorden aufgrund des Todes eines gerade initiierten Jungen, den eine Schlange im Jagd-Camp gebissen hatte: zwei Frauen (darunter die Mutter des Jungen), zwei verheiratete Männer und zwei ledige Mädchen begingen Selbstmord.
 Der Tod im kosmologischen Aspekt
Der Tod im kosmologischen Aspekt
Eine Antwort auf die sicherlich für jeden Leser verblüffende, geradezu unglaublich hohe Suizid-Rate unter diesem indigenen Volk – und vor allem die scheinbar nichtigen Anlässe für solche definitiven Entscheidungen – findet sich im kosmologischen Modell der Zuruahã. Darin sind alle Lebewesen mit einem mystischen Lebensprinzip ausgestattet – ihrem “karoji“ – und das “karoji“ der Menschenwesen ist die Seele (asoma) selbst. Und die Seele setzen sie gewissermassen gleich mit dem Herzen (giyzoboni), dem Sitz der Erinnerungen (wie sie meinen), der Emotionen, der Gefühle, der inneren Wahrheit – eines Tages sagte Ody zu mir: “Du sagst nein, aber dein Herz sagt ja“! Wenn jemand stirbt, verlässt ihn sein Herz/Seele und wartet auf dem Grund des Flusses auf den Anbruch der Regenzeit – und dann treibt es/sie die grösseren Flüsse hinab, springt und taucht im Himmel unter.
Nach Berichten von Günther Krömer (1994) glauben die Zuruahã an drei unterschiedliche Wege, die das Firmament kreuzen: der “mazaro agi“ (Weg des Todes) ist der Verlauf der Sonne, den die Personen einschlagen, die eines natürlichen Todes im Alter sterben – der “konaha agi“ (Weg des Timbó) ist der Verlauf des Mondes, dorthin gehen die Selbstmörder – und der “koiri agi“ (Weg der Schlange) ist die Spur des Regenbogens, der Weg für jene, die durch den Biss einer Schlange den Tod finden.
Damit befindet sich das karpologische Schicksal derer, die sich für den Suizid entschieden haben, zwischen der Wohnung des Urahnen Bai (dem Donner) – im oberen Teil des Himmels, wo die Seelen (asoma) ihre Verwandten wiedersehen und mit den authentischen “Konahamady“ (dem Timbó-Volk) ewig leben – und der Wohnung des Urahnen Tiwijo, im Osten – wohin sich die Seelen derer begeben, die in hohem Alter eines natürlichen Todes sterben. Die durch einen Schlangenbiss Verstorbenen verbleiben in einem intermedialen Raum, dem Regenbogen. Die Option im Haus des Tiwijo wird beschrieben als “ein schwieriger Weg, auf dem die Seelen ohne Ruhe und Frieden herumirren“ – aber er ermöglicht, paradoxerweise, ihre Verwandlung in ewig junge Menschenwesen. Dort ist das Leben angenehm, die Ackerpflanzen wachsen von allein, Jagd und Fischfang sind üppig. Die Quelle dieser Jugend, so sagen sie, ist “eine süsse Speise“, welche die ankommenden Seelen erhalten – das Alter vergeht im Grab, zusammen mit der Haut des Kadavers.
Man kann sagen, dass die Suizide, oder die Suizidversuche, in der Regel durch Konflikte und Krisen ausgelöst werden, die mit der Sorge um den Besitz (Werkzeuge und Felder) zusammenhängen, oder mit der Kontrolle der femininen Sexualität, der Selbstachtung (Beleidigungen, Krankheit, Hässlichkeit, Misserfolg), mit der Ehe (Heirat und den schwierigen ehelichen Beziehungen) und, vor allem, mit dem tiefen Gefühl, welches die Lebenden an die verstorbenen Angehörigen bindet. Man kann fast sagen, dass wir es hier mit einer Art “Sterbewirtschaft“ zutun haben, von der die Zuruahã-Gesellschaft regiert wird, denn es sind die Toten, die wiederum neue Todesfälle produzieren – mittels einer suizidalen Antwort auf Trauer und Bitterkeit.
Der Selbstmörder positioniert sich mit seiner verwegenen Haltung in einem Disput, der mit einem “Tauziehen“ zwischen den Toten und den Lebenden verglichen werden könnte. Die einen “ziehen“ die andern hinüber, um sie im Jenseits zu begleiten, eine Bewegung, die von einem Gefühl des plötzlichen Verlustes oder der Sehnsucht hervorgerufen wird – ein Gefühl, welches auch einige Zeit später noch in der Erinnerung haftet und in Träumen wiederkehrt. Jene, die verzweifelt versuchen, einen Selbstmordkandidaten vor sich selbst zu retten, entladen bei dieser Gelegenheit ihren ganzen Frust über denjenigen, der sie zu verlassen beabsichtigt.
In gewissen Situationen ist der Entschluss “konaha“ zu schlucken, auch die Realisierung einer Selbstbestrafung, wenn ihr Autor sich zum Beispiel verantwortlich fühlt für ein Unglück das einem anderen zugestossen ist. Es gibt da auch eine gewisse Parallele zu der Angewohnheit, Schnupftabak zu schnupfen – bei den Zuruahã besonders beliebt. Wenn sich jemand schuldig fühlt, entschliesst er sich eventuell, sich mit Schnupftabak zu betäuben – oder er kann von den Andern dazu gezwungen werden, weil sie über sein Verhalten empört sind.
 Schamanistisches Modell – Suizid-Modell
Schamanistisches Modell – Suizid-Modell
Eine Version der Tötung durch Hexerei – die sich “mazaro bahi” (Weg des Todes) nennt – soll unter den Zuruahã in der Vergangenheit existiert haben. In den genealogischen Registern wurden 13 Todesfälle identifiziert, die der Hexerei zugesprochen werden (neun Männer und vier Frauen), und die letzten dieser Fälle ereigneten sich zwischen Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre.
In den Erzählungen, die über die Taten ihrer grossen Schamanen im Umlauf sind, werden diese oft mit Zwistigkeiten zwischen Personen verschiedener Untergruppen erklärt. Man erzählt sich zum Beispiel, dass Aga, aus der Gruppe Masanidawa, eine verhexte Fledermaus gegessen hat und daran starb. Und das kam so: Aga war wütend, weil Birikahowy, von den Jokihidawa, sich mit einer Frau der Masanidawa verheiratet hatte. Beim Ringkampf (gaha) quetschte Aga den Birikahowy dermassen, dass dieser schwer verletzt sich an ihm rächte, indem er die Fledermaus verhexte – beide starben noch am gleichen Tag.
In einer chronologischen Perspektive jedoch sind solche “Causae mortis“ seit den 1960er Jahren selten geworden, und mit ihnen die grossen Schamanen (iniwa hixa) – parallel zu einer Zunahme der Todesfälle durch Suizid. Ungeachtet der Gefährlichkeit der Schamanen, bedauern die Zuruahã die Lücke, die durch ihre fehlenden “iniwa hixa“ entstanden ist, deren aussergewöhnliche Macht es ihnen erlaubte, an weit entfernte Orte zu reisen, ihre Feinde zu vernichten und sogar das Reich der Toten zu besuchen. Die zwei oder drei Männer, denen sie heute schamanistische Fähigkeiten zuschreiben, sind nichts weiter als “hosokoni“ – schwache Schamanen, deren Talent sich auf Kontakte mit den “korime“ (Geistern) beschränkt, die ihnen Gesänge beibringen und Neuigkeiten aus entfernten Teilen des Kosmos verkünden.
Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts unterteilten sich die Vorfahren der Zuruahã in verschiedene lokale Gruppen, die ihre eigenen Territorien besetzt hielten, und bei Streitigkeiten in denen Fremde verwickelt waren, schickten sie ihren Schamanen, um die Probleme zu lösen. Auf diese Weise wurden Krankheit und Tod seiner Rache zugeschrieben, seiner Kapazität, den “mazaro bahi“ zu kontrollieren. Heute, in der Gegenwart, finden wir lediglich eine gesellschaftliche und territoriale Einheit vor, in welcher der Suizid die häufigste Todesursache ist. Glücklicherweise ist im Verlauf der Veränderungen, die stattgefunden haben – sowohl in der Art zu leben, wie auch bezüglich der Beziehungen zur Aussenwelt – etwas Unerwartetes geschehen.
Man kann beobachten, dass aus der Vereinigung der von den verschiedenen Gruppen übrig gebliebenen Mitglieder, einerseits eine Verdichtung und Intensivierung des gesellschaftlichen Lebens resultierte (Interaktionen, Aufgaben, Querelen), und zum andern eine Einengung, die ein gesellschaftliches Leben “unter anderen“ eingeführt hat, was heissen soll: voller Aufregungen und Risiken – die Gefahr kommt fast immer von aussen, von den Anderen, jedoch sind die von aussen in diesem Fall innen drin, und die Anderen sind die Nachbarn des Hauses (kaho).
Es ist möglich, dass eine Korrelation existiert zwischen der früheren gesellschaftlichen Konfiguration, die aus multiplen lokalen Gruppen bestand, und der Ausübung schamanistischer Aktivitäten, so wie zwischen dem gegenwärtigen Zustand und den Selbstmorden. Im ersten Fall stellt die Macht des Schamanen eine interlokale Barriere dar, die irgendwelchen Bedrohungen von aussen Grenzen setzt. Im zweiten Fall entwickelt sich eine analoge Situation, jedoch im internen Bereich, indem die latente Bedrohung durch den Suizid die zwischenmenschlichen Beziehungen regelt. In dieser neuen Situation wird eine schamanistische Intervention zur logischen Unmöglichkeit: daher die Debilität der Schamanen, weil sie und ihre Kunst in einem vereinten Kollektiv keinen Platz mehr haben. Andererseits kann man den Suizid durchaus als eine Variante der “Hexerei“ ansehen, und es existieren Indizien für eine symbolische Verknüpfung zwischen beiden: wie Ohozyi erklärt, ist der “karoji“ (das mystische, vitale Prinzip) des Timbó “xamã“ – daher seine Anziehungskraft, sich der menschlichen Seelen zu bemächtigen.
Im ersten Moment möchte man meinen, dass die Zuruahã, mit ihrem Plan gesellschaftlichen Zusammenlebens agieren, wie eine homogene und gut integrierte Gruppe. Die Konstruktion des Hauses, die Fischzüge mit Timbó, die kollektiven Jagden, die Zeremonie der Tapir-Fleischverteilung, die Ernte-Riten, die nächtlichen Schnupftabak-Runden und die maskuline Initiation, sowie die unablässigen Anstrengungen zur Unterbringung aller Familien in einem einzigen Haus – obwohl es durchaus andere Häuser gibt, die für eine Unterbringung zur Verfügung stünden – alle diese Aktivitäten, eine jede auf ihre Art, beweisen einen ausgeprägten korporativen Geist und effektiven Gemeinschaftssinn.
Die einfache Idee, in der Nacht allein zu sein, an irgendeinem Ort ausserhalb ihres Dorfes, provoziert bereits Panik unter Freunden und Verwandten. Diese Angst, von der sie beherrscht werden, und die sie immer wieder befällt, denn sie werden nicht müde, über mögliche Aggressionen von ausserhalb ihrer Gesellschaft zu diskutieren, (die gefürchteten “zamady“ – Geister des Waldes, feindliche Indios, Latex-Sammler mit Feuerwaffen). Die Vermeidung von Zusammenstössen dieser Art ist tatsächlich einer der Gründe, dass sich die Zuruahã in die Isolation ihres gegenwärtigen Lebensraumes zurückgezogen haben – schon seit mehr als sechs Jahrzehnten – praktisch eingeschlossen in einer kleinen Parzelle ihres ehemaligen Territoriums.
Ungeachtet des Modells der Einheit und des Zusammenhalts, erscheint die “konaha“-Einnahme als eine Zuflucht, ein Kontrapunkt, der aus einem gewissen gesellschaftlichen Widerspruch entsteht, unterbrochen aber kontinuierlich. Hier handelt es sich um eine Operation, welche die Meinungsverschiedenheiten in den Grenzen der lokalen Gruppe verinnerlicht und propagiert, und die elementarsten Komponenten der gesellschaftlichen Struktur infrage stellt. Von da an ist jeder Akt und jeder Diskurs abhängig von dem, was man das „suizidale Potenzial“ nennen könnte.
Das selbstmörderische Verhalten unter den Zuruahã ist jedoch nicht als eine Ausschweifung oder Dysfunktion anzusehen, noch viel weniger als ein abwegiges Verhalten, sofern man bestimmte strukturelle Prinzipien versteht, welche diese Gesellschaft einzigartig machen, und dazu sollte man die folgenden kennen:
- Der Gegensatz zwischen Lebenden und Toten, wenn bei einem Selbstmordversuch die Verbindung zu einem Toten im Spiel ist und bei der Rettung des Selbstmörders, die Verpflichtung der Lebenden, über den Geretteten zu wachen.
- Die Asymmetrie zwischen Blutsverwandten und Verschwägerten, mit Betonung der Verbindungen entsprechend ihrer Herkunft.
- Die Dynamik der Altersgruppen, welche die Jugend und die Alten unterscheidet, besonders gegenüber ihrem späteren Schicksal.
- Der gesellschaftliche Status, welcher entweder eine gewisse Gleichgültigkeit oder eine Zunahme der potenziellen Suizidfälle auslösen kann.
- Schliesslich der Affront zwischen den Geschlechtern, der durch solche Geschehnisse noch gesteigert wird.
Alle diese Fakten im Gesamt dürften den Schluss zulassen, dass dem Suizid in dieser Gesellschaft eine bereits durch ihre kosmologischen Überlieferungen eingeleitete Bedeutung zugedacht ist, und dass sich in der rituellen Verwirklichung dieses Aktes keine Parallele unter den Indios Südamerikas findet.
 Produktive Aktivitäten
Produktive Aktivitäten
Ausser ihren alltäglichen, individuellen Aktivitäten auf den Pfaden, die sich vom Dorfplatz aus in alle Richtungen erstrecken, veranstalten die Zuruahã-Jäger zwei Arten von Jagdexpeditionen von längerer Dauer: die “kazabo“, ein Camp, in das sich die gesamte Familie begibt, und das über mehrere Wochen aufrecht erhalten wird – und die “zawada“, zu der nur die Männer ausrücken und etwa eine Woche ausbleiben.
Zur Jagd benutzen die Zuruahã grundsätzlich eine Art von Curare, einer Giftpaste, mit der sie die Spitzen der Blasrohrpfeile bestreichen. Zum Angeln benutzen sie Haken und Nylonschnur, oder sie organisieren kollektive Fischzüge, wobei sie die Fische mit pflanzlichen Giften betäuben. Dazu kultivieren sie auf ihren Feldern verschiedene Timbó-Spezies (“konaha“ ist eine Leguminose der Gattung „lonchocarpus“ deren aktives Prinzip “Rotenon“ genannt wird) und eine weitere, “Tingui“ (Jacquinia armillaris).
Tapire sind die begehrteste Jagdbeute, Gelegenheit zu einem ausgiebigen Verteilungs-Zeremoniell und anschliessenden kollektiven Zubereitung des Fleisches. Ausser dem Prestige, welches regelmässig zunimmt, gebührt den besten Jägern das Privileg, die Jagdbeute zu zerlegen und die Fleischstücke unter den Bewohnern zu verteilen.
Was den Ackerbau betrifft, sind die Felder weiträumig angelegt und mit einer grossen Vielfalt verschiedener Kulturen bepflanzt. Darunter überwiegen die verschiedenen Arten von Maniok, Zuckerrohr, Bananen und Knollenfrüchten. Das Sammeln einer enormen Vielfalt von Waldfrüchten, in allen Epochen des Jahres, vervollständigt die reichhaltige Nahrungspalette der Zuruahã.
Deutsche Übersetzung/Bearbeitung Klaus D. Günther